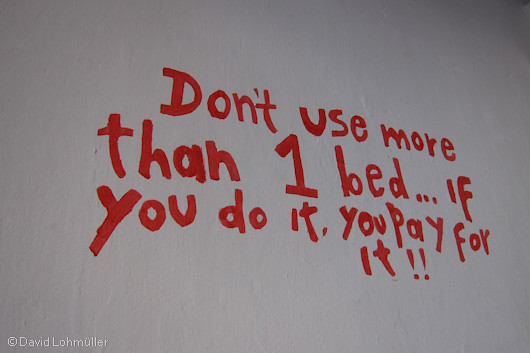Das Niemandsland zwischen Bolivien und Chile war ein einziges Gefälle. Kaum hatte ich im spektakulär gelegenen Grenzhäuschen Boliviens meinen Ausreisestempel in den Pass bekommen wurde ich einem Bus zugewiesen, der mich zu der Wüstenoase San Pedro de Atacama bringen sollte. Rechts flankiert von dem landschaftsüberragenden und schneebepuderten Vulkan Licancabur und links mit Aussicht auf die Unendlichkeit der Atacamawüste fuhren wir dann kurz darauf mehr als 2000 Höhenmeter hinab zum endgültigen Ziel meiner 3-tägigen Odyssee. Der rasende Abstieg von den Anden, dauerte insgesamt weniger als eine Stunde und wir mussten zwischendurch sogar anhalten, um die Bremsbeläge zu schonen, derart steil ging es wüstenwärts.
So grandios die Abfahrt durch das Niemandsland war, so anstrengend war schließlich der eigentliche Grenzübertritt nach Chile. Ein gefühltes Jahrtausend dauerte es, bis die Beamten unseren Bus, alle darin Reisenden und das Gepäck bis ins letzte Atom zerlegt und erfolglos nach verboten eingeführten Lebens- und Rauschmitteln untersucht hatten. Erdrückend dabei war vor allem die plötzlich vorhandene Hitze, die mit jedem verlorenen Höhenmeter rasch und ungewohnt angestiegen war und uns alle "kalt" erwischte. Seit Lima war es nicht mehr so hitzig gewesen auf meiner Reise und in meinen ersten Atacama Stunden hatte ich meine liebe Mühe, mich an diesen radikalen Temperaturwechsel zu gewöhnen. Der Akklimatisierung nicht sonderlich zuträglich war außerdem die atemstockende Trockenheit dieser Gegend und der Staub, der förmlich in der Luft stand.
Doch all diese Umstände konnten über eines nicht hinwegtäuschen. Mit dem Eintritt nach Chile war ich zweifelsohne wieder angekommen in der Zivilisation. Die ersten wagen Anzeichen dafür zeigten sich bereits auf den ersten Metern in Form von erkennbaren Mittelstreifen und ordentlichen Straßenschildern, welche frisch asphaltierte und schlaglochfreie Straßen säumten. Um einiges schockierender und auffälliger dagegen waren die Anzeichen, die San Pedro de Atacama ausstrahlte, denn dieses staubige Flecklein Gottes Erde war unfassbar übervölkert von Touristen. Mir war es ein ausgesprochenes Rätsel, wie all die Sonnenbrillen- und Kaki-Hemdenträger dort hingelangt waren, aber fest stand, sie waren da.
Gerade einmal 5000 Einwohner zählt das offensichtlich sehr beliebte Ziel für Wüsten Touristen aus aller Welt, und vermutlich liege ich nicht allzu weit von der Wahrheit entfernt wenn ich behaupte, dass jeder einzelne von diesen Einwohnern entweder in einem Hotel, einem Restaurant oder bei einem Tourenanbieter arbeitet. Nach all meinen Reisekilometern durch das vergleichsweise wenig erschlossene Bolivien tat ich mir zugegebenermaßen etwas schwer und war irritiert durch die ungewohnten Touristenmassen. Doch die kommerzielle Ausrichtung des Ortes hatte auch etwas Gutes: Es gab endlich Gelegenheit zum Wäsche waschen. Ich war absurd dreckig und es war allerhöchste Zeit, dass die wenigen noch in meinem Besitz verbliebenen T-Shirts - mein Bestand hatte in den letzten Wochen auf ominöse Art und Weise eine dramatische Dezimierung erfahren - wieder einmal einem reinigenden Waschgang ausgesetzt wurden.
Dies geschah gerade noch rechtzeitig vor dem geplanten Treffen mit Vanja, einer Freundin von zuhause, die sich angekündigt hatte, zeitgleich mit mir durch Chile zu reisen. Nach wochenlanger e-mail Korrespondenz hatten wir es nun tatsächlich geschafft, uns tatsächlich zu verabreden, und zwar hier in der Atacamawüste. In Lenor-frischer Garderobe holte ich sie und ihre holländische Reisekameradin am nächsten Tag vom Busbahnhof ab. Wir feierten ein freudiges Wiedersehen und verbrachten den Tag über viel Zeit mit dem Austausch erlebter Reisegeschichten, dem neuesten Klatsch und Tratsch von zuhause sowie heißen Tips und Tricks für die Weiterreise. Auch wenn es etwas eigenartig und nur schwer einzusortieren war, nach so langer Zeit und so weit weg von zuhause, ein bekanntes Gesicht zu treffen, so war es doch schön, wieder einmal ein Stück Heimat nahe zu wissen.
Der nächste Tag fühlte sich an nach Tatendrang. Ich lieh mir von einem der unzähligen Anbieter ein Mountainbike aus und machte mich auf zum 20 Kilometer entfernten, landschaftlichen Höhepunkt der Region, dem "Valle de la Luna" (Tal des Mondes). Das im Regenschatten der Anden gelegene Tal gilt als einer der trockensten Orte der Erde überhaupt. Hier gibt es Wetterstationen, die in ihrer Geschichte nicht einen einzigen Tropfen Niederschlag aufgezeichnet haben!
Dem entsprechend fühlte sich auch nach wenigen Kilometern mein Mund an. Ich konnte noch so viel Wasser trinken, der Dauerdurst wollte nicht vergehen. Die Lippen waren längst aufgeplatzt und meine Zähne knirschten permanent auf Sandstaub. Doch all dies konnte in keiner Weise meine Begeisterung für diese unwirkliche Gegend gefährden. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, sich einsam und mit sandigem Wind im Haar durch diese bizarre Landschaft zu bewegen. Nicht umsonst trägt das Tal seinen Namen. Denn ringsherum erhoben sich die skurrilsten Gesteinsformationen und eine eindrucksvolle Palette von Farben und Formen ließen den Untergrund wie die Oberfläche eines fremden Planeten erscheinen. Alles in allem, fühlte es sich wahrhaftig so an, als würde ich hier über den Mond radeln.
Nachdem ich das Tal einmal komplett durchquert hatte wartete zum krönenden Abschluss ein atemberaubender Sonnenuntergang auf der großen Düne. Da etliche Tourenanbieter dieses Ereignis ebenfalls in ihrem Programm hatten, war es dort um die Einsamkeit zwar geschehen, dafür traf ich aber noch einmal Vanja, die zusammen mit zwei anderen Mädels einen ereignisreichen Tourentag verbracht hatte und ebenfalls gekommen war, um das Verschwinden des großen Feuerballs zu beobachten. Dieser tauchte mit seinem Untergang die gesamte Umgebung in ein intensives und durchdringendes rot, so dass sich der Mond allmählich eher in eine Marslandschaft verwandelte.
Ob Mond oder Mars, bei einbrechender Dunkelheit kehrten wir mit unseren Raketen aus dem All zurück in die Stadt, wo wir gemeinsam zu Abend aßen, bis spät in die Nacht Gespräche führten und uns dann voneinander verabschieden mussten, da es für mich früh am nächsten Morgen schon wieder weiter ging auf die nächste Etappe meiner Reise: eine 24 Stunden Busfahrt durch die Atacama Wüste nach Santiago de Chile.
Fun Facts:
- Die Atacamawüste ist etwa 15 Millionen Jahre alt und gilt als die trockenste Wüste der Erde. Im Durchschnitt fällt hier nur etwa 1/50 der Regenmenge, die im Death Valley in den USA gemessen wird.
- Speziell das Valle de la Luna ("Tal des Mondes") gilt als einer der trockensten Orte der Erde überhaupt. In dieser Gegend gibt es Wetterstationen, die in ihrer Geschichte nicht einen einzigen Tropfen Niederschlag aufgezeichnet haben.
- Wegen seiner lebensfeindlichen Umgebung wurden im Valle de la Luna von der NASA unter anderem die Prototypen des Mars Rover getestet.
- Die reichen Nitratvorkommen der Atacamawüste waren Auslöser für den Salpeterkrieg (1879-1884). Chile gewann den Krieg gegen Bolivien und Peru mit britischer Unterstützung und konnte dadurch nach Norden hin sein Land erweitern.
- In Sichtweite von San Pedro de Atacama befindet sich der 5920 m hohe Lincancabur Vulkan. In dessen Krater liegt der höchstgelegene See der Erde.
Checklist:
- Rad gefahren auf dem Mond
- Sonnenuntergang beobachtet auf einer Düne in der trockensten Wüste der Erde